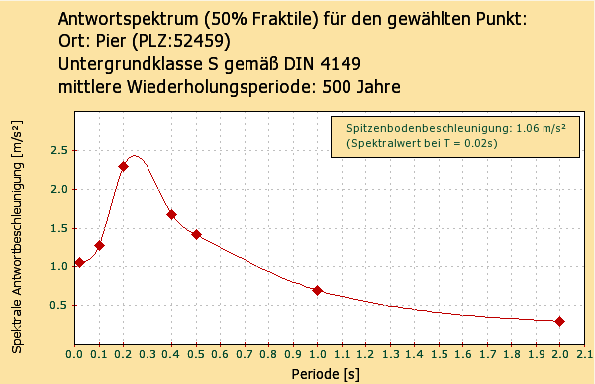-
R i c h t l i n i e
für die Untersuchung der Standsicherheit
von Böschungen der im Tagebau betriebenen Braunkohlenbergwerke
(Richtlinie für Standsicherheitsuntersuchungen - RfS -)Neufassung mit 1. Ergänzung vom 08.08.2013 - 61.19.2-2-1 -
1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie gilt für die Untersuchung und Beurteilung der Standsicherheit von
Randböschungen und bleibenden Böschungen der Braunkohlentagebaue und der
zugehörigen Hochkippen sowie Restseen. Auf Betriebsböschungen findet diese
Richtlinie keine Anwendung.2 Begriffe
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten folgende Begriffe:
2.1 Böschung:
Gebirgskörper mit künstlich hergestellter geneigter Geländeoberfläche.
2.2 Einzelböschung:
Abschnitt oder Teil einer Böschung, der durch Ebenen (Bermen) begrenzt wird.
2.3 Böschungssystem:
Aus mehreren Einzelböschungen bestehender Gebirgskörper.
2.4 Randböschung:
Böschung, die entlang zur Abbaugrenze des Tagebaus angelegt und zu einem
späteren Zeitpunkt überkippt, überbaggert oder umgestaltet wird.2.5 Bleibende Böschung:
Böschung, die weder überkippt noch überbaggert wird, sondern als Landschafts-
bestandteil auf Dauer bestehen bleibt.2.6 Böschungsrandbereich:
Bereich im Vorfeld einer Rand- oder bleibenden Böschung, für den durch Stand-
sicherheitsuntersuchungen nachzuweisen ist, dass eine Gefährdung nicht vorhanden
ist.2.7 Potenzielle Gleitfläche:
Mögliche oder gedachte gekrümmte oder ebene Fläche im Gebirge, auf der infolge
von Bruchverformungen Bewegungen stattfinden können.2.8 Gleitlinie:
Schnittlinie der untersuchten Gleitfläche in der betrachteten Schnittebene.
2.9 Grenzgleichgewicht:
Rechnerisches Gleichgewicht zwischen den einer Bewegung an der Gleitfläche/Gleitlinie
widerstehenden und den treibenden Kräften im Gebirgskörper.2.10 Böschungsverformung:
Bewegung der Böschung aufgrund von Ent- oder Belastungsvorgängen oder sonstigen
Einwirkungen.2.11 Böschungsumbildung:
Geometrische Veränderung im oberflächennahen Bereich, wie z.B. kleinere Böschungs-
ausbrüche, Bodenbewegungen oder Erosionen.2.12 Böschungsrutschung:
Tiefgreifende geometrische Veränderung einer Böschung infolge Unterschreitung des
Grenzgleichgewichtes.2.13 Maßnahmen zur Erhaltung oder Erhöhung der Standsicherheit:
Betriebliche Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Erhöhung der widerstehenden Kräfte im
Gebirge (z. B. unmittelbares Nachführen der Innenkippe, Stützschüttungen am Böschungs-
fuß, Reduzierung der Grundwasserstände) oder zur Reduzierung der treibenden Kräfte im
Gebirge (z. B. Entlastungsbaggerungen am Böschungskopf, zusätzliche Entwässerungs-
maßnahmen).2.14 Rutschungsbegünstigende Verhältnisse liegen vor bei:
- tektonischen Beanspruchungszonen, Schichtgrenzen oder Schichten mit geringer
Scherfestigkeit, insbesondere wenn diese gleichsinnig mit der Böschungsneigung
einfallen, - ungünstigen hydrologischen Verhältnissen, (z. B. freie oder gespannte Restwasser-
stände, Wasserzuflüsse, Wasseransammlungen am Böschungsfuß) welche die
Standsicherheit durch Verminderung der Festigkeiten oder durch hydromechanische
Wirkungen (z. B. Auftrieb, Strömungsdruck, Wellenschlag) herabsetzen, - statischen Zusatzlasten oder Erschütterungen (z.B. durch Verkehrsanlagen),
- alten Grubenbauen, Kohlepfeilern oder -festen und ehemaligen Kippen.
2.15 Zu schützende Objekte sind:
Innerhalb des Böschungsrandbereichs gelegene
- nichtbetriebliche bauliche Anlagen und Gebäude, die für den ständigen oder
zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind sowie Industrieanlagen - Einrichtungen und Bauwerke, die dem öffentlichen Verkehr dienen
- Hauptversorgungs- und Entsorgungsleitungen
- Gewässer mit ständiger Wasserführung, Stauanlagen, Schlamm- und Klärteiche
und sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen - Naturschutzgebiete und Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung.
Darüber hinaus können im Einzelfall weitere zu schützende Objekte durch die
Bergbehörde festgelegt werden.3 Grundsätze
(1) Der Unternehmer hat der Bergbehörde die Standsicherheit von Randböschungen und
0) Arbeiten an Böschungen dürfen nur fachkundigen Beschäftigten übertragen und müssen
bleibenden Böschungen nachzuweisen. Der Nachweis einer hinreichenden Standsicherheit
dient dem Schutz der im Tagebau beschäftigten Personen 0), der betrieblichen Anlagen
und insbesondere auch der im Böschungsrandbereich liegenden zu schützenden Objekte.
entsprechend den Anweisungen des Unternehmers ausgeführt werden. Bei der Herstellung
von Böschungen sind insbesondere die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 bis 5 der
Allgemeinen Bundesbergverordnung (ABBergV) vom 23.10.1995 zu beachten. (2) Aufgrund zunehmender Gewinnungsteufen sind eine richtige Bemessung der Tagebau-
randböschungen und deren zutreffende standsicherheitliche Beurteilung auch aus betriebs-
und volkswirtschaftlichen Gründen geboten, um eine möglichst vollständige Gewinnung
der Lagerstätte zu ermöglichen.(3) Böschungen sind so anzulegen und zu unterhalten, dass die Sicherheit des Bergwerk-
betriebs, die persönliche Sicherheit und die zu schützenden Objekte während der
vorgesehenen Standzeit nicht gefährdet werden. Um Rutschungen zu vermeiden, müssen
die standsicherheitlichen Erfordernisse bereits bei der Planung der Böschungen in
hinreichender Weise berücksichtigt werden. Dies setzt eine rechtzeitige Erkundung der
geologischen und hydrologischen Gegebenheiten voraus.(4) Bei der Herstellung von Kippenböschungen hat der Böschungsaufbau, die Schüttweise
und die Verteilung der Lockergesteinsmassen unter Berücksichtigung der Eigenschaften
des zu verkippenden Materials und des Untergrundes zu erfolgen.(5) Während der Betriebsdauer des Tagebaus ist für eine ausreichende Bewirtschaftung
der Böschungsflächen und Unterhaltung notwendiger wasserwirtschaftlicher Anlagen
Sorge zu tragen. Bleibende Böschungen sind unter Berücksichtigung der endgültigen
wasserwirtschaftlichen und bodenmechanischen Verhältnisse dauerhaft standsicher so
anzulegen, dass eine regelmäßige Unterhaltung und eine Überwachung der Verformungen
nach Einstellung des Betriebs nicht erforderlich sind.(6) Verformungen von Randböschungen müssen während der Betriebsdauer überwacht
werden (§ 37 Abs. 2 BVOBr). Ergeben sich aufgrund der Überwachung Hinweise auf
eine mögliche Entstehung von gefahrbringenden Gebirgs- oder Bodenbewegungen, so
hat der Unternehmer unverzüglich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen. Gefährd-
ungsbereiche sind durch geeignete Maßnahmen gegen das Betreten durch betriebsfremde
Personen zu sichern, soweit es die persönliche Sicherheit erfordert. Art und Umfang der
erforderlichen Maßnahmen sind durch den Unternehmer, ggf. in Abstimmung mit der
Bergbehörde, festzulegen.(7) Bei Wasseraustritten aus dem Böschungskörper sind geeignete betriebliche
Maßnahmen zur Fassung und Ableitung der Wässer durchzuführen. Die Austrittsstelle
ist - soweit erforderlich - zur Vermeidung rückschreitender Erosionen, z.B. durch das
Aufbringen einer Filterschicht, zu sichern.(8) Soweit Anzeichen für eine Bruchverformung oder beginnende Rutschung erkannt
werden, sind gefährdete Personen unverzüglich zu warnen, die Gefahrenbereiche
abzusperren und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Böschung einzuleiten.4 Nachweis der Standsicherheit
4.1 Zum Nachweis der Standsicherheit dienen
- geotechnische Untersuchungen (geologische, hydrogeologische und geo-
mechanische Untersuchungen), - markscheiderische Unterlagen,
- Berechnungen der Standsicherheit,
- Beurteilungen der Standsicherheit,
- Ergebnisse von Beobachtungsmaßnahmen.
4.2 Geotechnische Untersuchungen
4.2.1 Geologische Untersuchungen
Zu den geologischen Untersuchungen gehören Beschreibungen des anstehenden Locker-
gebirges einschließlich der Liegendschichten, des Materialaufbaus der Kippen, der Kippen-
basisfläche und des Kippenuntergrundes, soweit diese Angaben für die Standsicherheit
relevant sind. Geologische Untersuchungen sind grundsätzlich durchzuführen;
rutschungsbegünstigende Verhältnisse sind anzugeben.4.2.2 Hydrogeologische Untersuchungen
Zu den hydrogeologischen Untersuchungen gehört die Beschreibung der hydrologischen
und geologischen Verhältnisse im Bereich der zu untersuchenden Böschung. Bei den
Standsicherheitsuntersuchungen sind sowohl die zum Zeitpunkt der Herstellung der
Böschung bestehenden Verhältnisse als auch die zu erwartenden Bedingungen während
der voraussichtlichen Standzeit der Böschung zu berücksichtigen.4.2.3 Geomechanische Untersuchungen
(1) Durch geomechanische Untersuchungen im Gelände und Labor werden die boden-
physikalischen Eigenschaften des anstehenden Lockergebirges einschließlich des
Liegenden und der zu verkippenden Massen umfassend beschrieben. Hierzu sind die
maßgebenden Bodenkenngrößen (wie z. B. Bodenart, Klassifikation, Lagerungsdichte
bzw. Konsistenz, Scherfestigkeit) zu ermitteln.1) 2)(2) Geomechanische Untersuchungen sind dann durchzuführen, wenn auf Grund der
geologischen Untersuchungen eine Beurteilung der Standsicherheit nicht möglich ist und
bisher keine ausreichenden Untersuchungsergebnisse und Erfahrungen über die boden-
physikalischen Eigenschaften des anstehenden Lockergesteins vorliegen. Die Bedingungen
für eine ggf. notwendige Fortschreibung der geomechanischen Untersuchungen sind
anzugeben.(3) Sind stark streuende Kennwerte für einen zu untersuchenden Bereich zu berück-
sichtigen, so ist zunächst eine statistische Auswertung mit dem Ziel vorzunehmen,
statistisch gesicherte Werte zu erhalten.3) Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei
feinkörnigen Bodenschichten (Tone, Schluffe) über längere Zeiträume Veränderungen
der Scherparameter eintreten können. Bei bleibenden Böschungen sollten insoweit auch
die Restscherfestigkeiten ermittelt werden.(4) Für bleibende Kippenböschungen sind die bodenphysikalischen Eigenschaften der
1) DIN-Normen zu geotechnischen Untersuchungen sind zu beachten.
Kippenböden zu ermitteln.2) Die Scherfestigkeit in Schichtflächen, Störungen und Klüften ist, soweit möglich, zu untersuchen.
3) Die Scherfestigkeit kann auch anhand anderer maßgebender Bodenkenngrößen durch
Korrelationen abgeleitet werden.4.2.4 Lage der geologischen Schnitte
Der geologische Schnitt für die Standsicherheitsuntersuchungen eines Böschungsab-
schnittes ist so zu legen, das insbesondere die unter Nr. 2.14 und 2.15 genannten
Verhältnisse berücksichtigt werden.4.3 Markscheiderische Unterlagen
Vorliegende markscheiderische Unterlagen sind zu berücksichtigen. Besondere
Verhältnisse im Böschungsbereich, wie z.B. alte Grubenbaue, Altkippen, Verfüllungen,
Kohlepfeiler oder -festen oder frühere Abbaugrenzen etc., sind entsprechend den
markscheiderischen Unterlagen darzustellen.4.4 Standsicherheitsberechnungen
(1) Standsicherheitsberechnungen sind als wesentliche Beurteilungsgrundlage für den
Nachweis im Sinne von § 37 Abs. 1 der Bergverordung für Braunkohlenbergwerke (BVOBr)
vom 05.02.1998 erforderlich, wenn die Standsicherheit nicht bereits aufgrund bisheriger
Erfahrungen und Nachweise als gegeben anzusehen ist.(2) Standsicherheitsberechnungen sind in der Regel anzufertigen, wenn
- die Standsicherheit nach Beurteilung der durchgeführten geotechnischen
Untersuchungen nicht als gegeben anzusehen ist, - zu schützende Objekte im Böschungsrandbereich vorhanden sind,
- rutschungsbegünstigende Verhältnisse vorliegen oder
- die zuständige Behörde dies im Einzelfall 4) verlangt.
(3) Standsicherheitsberechnungen sind unter Verwendung der Ergebnisse der geo-
technischen Untersuchungen nach Verfahren durchzuführen, die für die vorliegenden
Gegebenheiten geeignet sind und dem Stand der Technik entsprechen. In der Regel
sind die Berechnungen sowohl unter Ansatz gemittelter wie auch unter Ansatz
ungünstiger bodenmechanischer Kennwerte durchzuführen; der Einfluss des
Kennwerteansatzes auf die Standsicherheit ist durch Vergleichsberechnungen zu
ermitteln.(4) Die anzuwendenden Berechnungsverfahren und Rechenprogramme sind der
4) Die Bergbehörde wird in der Regel bereits bei der Prüfung von Rahmen- und
Bezirksregierung Arnsberg - Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW (Bergbehörde)
- unter Beifügung der zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zur Zustimmung anzuzeigen.
Die nachstehend aufgeführten Berechnungsverfahren für ebene Bruchmechanismen
wurden geprüft und entsprechen den Anforderungen.
Hauptbetriebsplänen entscheiden, für welche Böschungen die Anfertigung von Stand-
sicherheitsberechnungen erforderlich ist.4.4.1 Lamellenverfahren 5)
(1) Bruchmechanismen können in vielen Fällen durch kreisförmige Gleitlinien realistisch
beschrieben werden. Für den zu untersuchenden Böschungsbereich sind geologische
Schnitte mit Darstellung der Schichten, der Verwerfungen und Schichtgrenzen und
sonstiger Schwächezonen, der Grundwasserstände bzw. Entwässerungsziele und der
Böschungsgeometrie zu erstellen und danach die möglichen Gleitflächen festzulegen.
Der zu untersuchende Böschungsbereich wird entsprechend den von der Gleitlinie
durchschnittenen Lockergesteinsschichten in lotrechte Lamellen eingeteilt.(2) Die zu untersuchenden Gleitlinien sind unter Berücksichtigung von gebirgsmech-
anischen Schwächezonen festzulegen. Die in standsicherheitlicher Hinsicht maßgebenden
ungünstigsten Gleitlinien sind rechnerisch zu ermitteln.(3) Bei Vorhandensein von Restwasserständen im betrachteten Böschungsbereich sind
der Porenwasserdruck entsprechend der Höhe des Wasserstandes und die Wichte des
wassergesättigten Bodens zu berücksichtigen. Ggf. sind auch auf den Böschungskörper
einwirkende statische Zusatzlasten zu berücksichtigen.(4) Die Berechnung der Standsicherheit ist mit dem Berechnungsverfahren nach BISHOP,
das beispielhaft in DIN 4084 erläutert ist, durchzuführen.(5) Darüber hinaus können zusätzliche Standsicherheitsberechnungen nach anderen im
Braunkohlenbergbau erprobten Verfahren (z.B. die Verfahren nach B.O.R. oder JANBU)
durchgeführt werden.(6) Das Berechnungsverfahren nach BISHOP ist nur für kreiszylindrische Gleitflächen
5) Das Verfahren ist in der DIN 4084 näher beschrieben.
anzuwenden; bei abschnittsweise geraden Gleit- bzw. Bruchlinienabschnitten sind
Berechnungen, z.B. gem. Abschnitt 4.4.2 erforderlich.4.4.2 Zusammengesetzte Bruchmechanismen mit geraden Gleitlinien (Starrkörpermethode) 6)
(1) Aufgrund der tektonischen Gegebenheiten im Rheinischen Braunkohlenrevier ist es
bei tiefergehenden Bruchmechanismen erforderlich, auch Gleitlinien zu betrachten, die
entsprechend den im Gebirgskörper vorgegebenen Schwächezonen abschnittsweise gerade
verlaufen. Die einzelnen Bruchkörper können dabei Bewegungen nur parallel zu äußeren
Gleitlinien ausführen. Bei dem auch als Starrkörpermethode bezeichneten Verfahren
werden Bruchmechanismen betrachtet, die kinematisch möglich und mathematisch
eindeutig zu lösen sind. Das Verfahren ist vorrangig für Bruchkörper anzuwenden, bei
denen die Lage der äußeren und inneren Gleitlinien durch gebirgsmechanische Schwäche-
zonen, wie z.B. geringmächtige Tonhorizonte und Verwerfungen, eindeutig vorgegeben ist.(2) Die Untersuchung ist für die ungünstigsten Bruchmechanismen durchzuführen.
(3) Zur Ermittlung des Standsicherheitskoeffizienten nach FELLENIUS wird eine
6) Die Methode ist in der DIN 4084 näher beschrieben.
gleichmäßige Abminderung der Scherfestigkeitsparameter über alle Gleitlinien vorgenommen.4.5 Beurteilung der Standsicherheit
(1) Unter Verwendung der Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen, der
markscheiderischen Unterlagen und der Berechnungsergebnisse ist unter Berück-
sichtigung der bisherigen Erfahrungen zu beurteilen, ob die Böschung standsicher ist.(2) Soweit Standsicherheitsberechnungen durchzuführen sind, ist der erforderliche
Standsicherheitskoeffizient je nach Umfang der geotechnischen Untersuchungen,
der Zuverlässigkeit der angesetzten geomechanischen Kennwerte und unter Berück-
sichtigung des Gefährdungspotenzials der im Böschungsrandbereich gelegenen zu
schützenden Objekte, der vorgesehenen Standzeit der Böschung und des Lager-
stättenschutzes für jede betrachtete Schnittebene festzulegen und zu begründen.(3) Der rechnerisch ermittelte Standsicherheitskoeffizient
von Einzelböschungen
und Böschungssystemen muss für den ungünstig anzunehmenden Fall angemessen
über 1,0 liegen.(4) Bei zu schützenden Objekten im Böschungsrandbereich und bei bleibenden
für das Böschungssystem
Böschungen muss der Standsicherheitskoeffizient
mindestens 1,3 betragen. Ein Unterschreiten des v.g. Wertes bedarf einer einzel-
fallbezogenen Begründung.(5) Bei der Beurteilung der Standsicherheit von Böschungen können auch die räumliche
Einspannung des Böschungsfußes 7) sowie Maßnahmen zur Erhaltung oder Erhöhung
der Standsicherheit und zur Beobachtung der Böschung berücksichtigt werden. Die
geplante Nutzung muss berücksichtigt werden.(6) Bei bleibenden Böschungen von Restseen und von Hochkippen sind zusätzlich
7) Bei rutschungsbegünstigenden Verhältnissen sowie bei der sog. Zusatzkohlengewinnung
die durch mögliche Erdbeben bedingte Einwirkungen nach Maßgabe der
1. Ergänzung zu berücksichtigen.
am Böschungsfuß hat es sich im Rheinischen Braunkohlenrevier bewährt, die Länge der
freigeschnittenen Randböschung auf der untersten Sohle auf einem schmalen Bereich zu
begrenzen. Dazu wird die Innenkippe der Gewinnungsböschung in einem möglichst geringen
Abstand nachgeführt. Durch die seitlichen Stützkräfte des noch anstehenden Abbaublockes
einerseits und der unmittelbar nachgeführten Innenkippe andererseits wird die Standsicher-
heit gegenüber der rechnerisch betrachteten unendlich langen Böschung erhöht; Verform-
ungen des Gebirges werden vermindert. Der räumliche Einfluss der das sog. Abbaufenster
begrenzenden seitlichen Stützkörper kann für den Standsicherheitsnachweis qualitativ
berücksichtigt werden.5 Beobachtungsmaßnahmen
(1) Die Verformungen von Randböschungssystemen sind gem. § 37 Abs. 2 BVOBr
zu überwachen. Mit geeigneten Messverfahren, wie z.B. der elektro-optischen Distanz-
messung, werden horizontale Bewegungsbeträge der Böschungsoberfläche ermittelt.
Durch empirische Auswertungsverfahren können bei hinreichend kurzen Messintervallen
Erkenntnisse gewonnen werden, die dazu beitragen, die festgestellten Bewegungen als
unkritische Entlastungsvorgänge des Gebirges aufgrund der Massenentnahme oder als
beginnende Bruchverformungen zu bewerten.(2) Signifikant erhöhte Geschwindigkeiten mehrerer Messpunkte eines Böschungs-
bereiches oder Verformungsgeschwindigkeiten des Böschungskörpers, die nach
erfolgter Massenentnahme nicht wieder auf ein als unkritisch anzusehendes Gesch-
windigkeitsniveau absinken, können erste Anzeichen für sich im Gebirge ausbildende
Gleitflächen darstellen. In diesem Fall sind unverzüglich geeignete Maßnahmen zur
Sicherung des Böschungssystems und ggf. zur Abwehr von Gefahren einzuleiten.(3) Durch Neigungsmessungen (sog. Vertikal-Inklinometermessungen) in dafür
ausgerüsteten Bohrlöchern können innerhalb des Böschungskörpers ablaufende
horizontale Verschiebungen gemessen und die verschiebungsaktiven Horizonte
bestimmt werden.(4) Die Beobachtungen des Verformungsverhaltens tragen dazu bei, beginnende
Böschungsrutschungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen zur
Sicherung der Böschung einzuleiten.(5) Die für einen Böschungsabschnitt insgesamt erforderlichen Mess- und
Beobachtungsmaßnahmen (Überwachungskonzept) sind in Abhängigkeit von
den standsicherheitlichen Erfordernissen festzulegen und zu begründen.6 Vorlage und Inhalt von Betriebsplänen
6.1 Betriebspläne
Für das Anlegen und Umgestalten von Randböschungen und bleibenden Böschungen
sind in der Regel bergrechtliche Betriebspläne zur Zulassung einzureichen.
Die Ergebnisse der Standsicherheitsuntersuchungen und deren Beurteilung können in
Sonderbetriebsplänen für Standsicherheitsuntersuchungen dargelegt werden.6.2 Mustergliederung
"Sonderbetriebsplan für Standsicherheitsuntersuchungen":- Allgemeine Angaben
- Lage, Standdauer
- Abbau- bzw. Verkippungsverfahren
- zu schützende Objekte
- geologische Verhältnisse
- hydrogeologische Verhältnisse
- Böschungsgeometrie - Standsicherheitsberechnungen
- Erläuterung der Verfahren
- geomechanische Kennwerte
- Lamellenverfahren
- Starrkörpermethode
- Darstellung der Berechnungsergebnisse - Standsicherheitsbeurteilung
- erforderliche Standsicherheitsbeiwerte, Festlegung und Begründung
- Maßnahmen zur Erhaltung oder Erhöhung der Standsicherheit
- Beobachtungsmaßnahmen - Anlagen
- Übersichtsplan in einem geeigneten Maßstab mit Darstellung der Böschungs-
geometrie, der Schnittspuren unter Angabe wichtiger Aufschlüsse sowie zu
schützender Objekte
- Schnitte durch den Böschungsbereich und das Liegende in einem geeigneten
Maßstab mit Eintragung der wichtigen verfügbaren Aufschlüsse
- Dokumentation der schichtspezifischen Kennwerte und Erläuterungen
- Ergebnisse der Standsicherheitsberechnungen; Darstellung der untersuchten
Gleitkreise und Bruchmechanismen in Schnittzeichnungen
7 Prüfung durch Sachverständige oder sachverständige Stellen
Soweit Standsicherheitsuntersuchungen als Nachweis im Sinne § 37 Abs. 1 BVOBr
1. Ergänzung der RfS vom 08.08.2013
dienen, sind diese im Rahmen des bergrechtlichen Zulassungsverfahrens durch den
Geologischen Dienst NRW oder durch Sachverständige bzw. sachverständige Stellen,
welche die Bergbehörde hierfür benannt hat, zu prüfen. Sachverständige müssen die
für Ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen sowie über
die erforderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen.1 Anwendungsbereich
Diese Ergänzung gilt für die Berücksichtigung von Erdbebeneinwirkungen bei
bleibenden Böschungen von Restseen und von Hochkippen der Braunkohlentagebaue
in Nordrhein-Westfalen.2 Begriffe
Für die Anwendung dieser Ergänzung gelten folgende Begriffe:
2.1 Bemessungserdbeben:
Das für den Nachweis der Standsicherheit jeweils zu Grunde zu legende Erdbebenereignis.
2.2 Bodenbeschleunigung:
Beschleunigung des Bodens infolge Bemessungserdbeben. Wird als Zeitverlauf bei
dynamischen Verfahren zur Untersuchung von Erdbebeneinwirkungen auf Böschungen verwendet.2.3 Spitzenbodenbeschleunigung (PGA1):
Maximale Amplitude des Beschleunigungszeitverlaufs des Bemessungserdbebens.
Die Spitzenbodenbeschleunigung wird beim pseudo-statischen Standsicherheitsnachweis
von Böschungen verwendet.2.4 seismischer Koeffizient (k):
Faktor, mit dem, ausgehend von der Erdbeschleunigung (g), die für pseudo-statische
Standsicherheitsberechnungen anzusetzende Beschleunigung (a) ermittelt werden kann.Es gilt: a = k · g
1Peak Ground Acceleration
2.5 pseudo-statischer Koeffizient (
):Faktor, mit dem ausgehend von der Spitzenbodenbeschleunigung (PGA) die für
pseudo-statische Standsicherheitsberechnungen anzusetzende Beschleunigung (a)
ermittelt werden kann.Es gilt: a =
· PGA2.6 Hochkippe:
Abraumhalde, die durch das Aufschütten von Abraum oberhalb der umgebenden
Geländeoberfläche entstanden ist.2.7 Restsee:
Stehendes Gewässer in einem Tagebaurestraum.
2.8 Seeböschungen:
Bleibende Böschungen, die eine Seemulde bilden bzw. direkt an den Restsee anschließen.
2.9 Wiederkehrperiode:
Die Wiederkehrperiode ist der Kehrwert der statistisch bestimmten jährlichen
Überschreitenswahrscheinlichkeit, mit der an einem Standort eine bestimmte seismische
Bodenbewegung erreicht oder überschritten wird.3 Grundsätze
3.1 Die Auswirkungen von Erdbeben auf bleibende Böschungen sind mittels
pseudo-statischer oder dynamischer Verfahren zu untersuchen.3.2 Voraussetzung für die Untersuchung mit diesen Verfahren ist das Nichtauftreten von
Verflüssigungseffekten der Materialien, mit denen die Böschungen hergestellt werden.
Bleibende Böschungen sind so zu gestalten und aufzubauen, dass eine Bodenverflüssigung
nicht zu besorgen ist. Dies hat der Unternehmer in geeigneter Weise darzulegen.3.3 Die Festsetzung der Wiederkehrperiode2 und die Ermittlung der
zugehörigen Bodenbeschleunigungen für den Standsicherheitsnachweis
sind wie folgt vorzunehmen:
3.3.1 für bleibende Böschungssysteme von Restseen
- bis zum Erreichen des endgültigen Wasserstandes (Befüllphase):
Bemessungserdbeben 1 - Wiederkehrperiode T = 500 Jahre - nach Erreichen des endgültigen Wasserstandes (Endzustand):
Bemessungserdbeben 2 - Wiederkehrperiode T = 2.500 Jahre
3.3.2 für bleibende Einzelböschungen von Restseen und bleibende Böschungen von Hochkippen
- Bemessungserdbeben 1 - Wiederkehrperiode T = 500 Jahre
2Diese Festlegung erfolgt in Anlehnung an DIN 19700-10, wonach große Talsperren der
Klasse 1 gegen globales Versagen für Erdbebeneinwirkungen mit einer Wiederkehrperiode
von 2.500 Jahren auszulegen sind (Eintrittswahrscheinlichkeit 4·10-4). Gegenüber dem
Eurocode 8 werden damit für Böschungssysteme von Restseen höhere Beschleunigungen
angesetzt (Wiederkehrperiode Eurocode 8: T = 475 Jahre). Die Bemessung der Restsee-
böschungen wird damit bereits im Hinblick auf eine spätere bauliche Nutzung, für die die
Anforderungen der DIN EN 1998 (Eurocode 8) zu berücksichtigen sind, ausgelegt.3.4 Die Spitzenbodenbeschleunigung (PGA) an der Geländeoberfläche ist aus einer
ortsbezogenen Datenabfrage zu Erdbebengefährdung beim GFZ Potsdam [4] oder durch
ein standortspezifisches seismisches Gutachten des Geologischen Dienstes NRW, bzw.
einer anderen fachkundigen Stelle zu ermitteln. Wird die Beschleunigung am Grundgebirge
ermittelt, ist dabei eine Bodenverstärkung durch die vorhandene Sedimentüberdeckung zu
berücksichtigen.3.5 Horizontale und vertikale Komponenten von Erdbebeneinwirkungen sind als gleichzeitig
wirkend anzunehmen. Dabei ist die Beschleunigung stets für eine Horizontalkomponente in
Richtung der offenen Böschung anzusetzen. Für die Vertikalbeschleunigung sind beide
möglichen Richtungen in unterschiedlichen Rechengängen zu betrachten. Sofern nur die
Angabe zur horizontalen Erdbebenbeschleunigung vorliegt, ist aus dieser die Vertikal-
beschleunigung mit dem Faktor 0,7 zu ermitteln.3.6 Bei Anwendung dynamischer Verfahren ist die durch Erdbeben hervorgerufene
Bodenbeschleunigung entsprechend ihres Zeitverlaufs ohne Abminderung anzusetzen.3.7 (1) Kommen pseudo-statische Verfahren zur Anwendung, ist die durch Erdbeben
abzumindern. Die Größe von ist in Abhängigkeit
hervorgerufene maximal auftretende Beschleunigung PGA unter Verwendung des
pseudo-statischen Koeffizienten
von der Wiederkehrperiode sowie der Lage der Bruchmechanismen (oberflächennahe
oder tiefe Bruchmechanismen) festzusetzen [1].(2) Die Auswirkungen der Erdbebenbeschleunigung auf das Porenwasser in der
Böschung und den Wasserspiegel im Restsee sind mittels geeigneter Verfahren zu
berücksichtigen (z. B. [11], [12], [13]).4 Anzusetzende Koeffizienten
4.1 Die Berechnung mittels pseudo-statischer Verfahren ist mit den Koeffizienten in
Tabelle 1 vorzunehmen.Wiederkehrperiode
T
pseudo-statischer Koeffizient
oberflächennahe
Bruchmechanismen3(≤ 10 m)
tiefe
Bruchmechanismen4(> 150 m)
500 Jahre 0,25
0,10
2500 Jahre 0,25
0,10
Tabelle 1 Für bleibende Böschungen empfohlene pseudo-statische Koeffizienten
(nach [1])4.2 Sofern von den in Tabelle 1 genannten Werten abweichende Koeffizienten verwendet werden,
sind diese im Einzelfall zu begründen.5 Beurteilung der Standsicherheit
5.1 Die mit pseudo-statischen Verfahren für den Erdbebenfall ermittelte Standsicherheit
von bleibenden Einzelböschungen und Böschungssystemen muss über dem Grenzgleichgewicht
= 1,0 liegen.5.2 Soweit die rechnerisch ermittelte Standsicherheit
≤ 1,0 ist, müssen die im Erdbebenfall
zu erwartenden Verformungen der bleibenden Böschung mittels weiterführender dynamischer
Untersuchungen ermittelt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen und des Risikos gutachterlich
bewertet werden.3Als oberflächennah werden hier solche Bruchmechanismen bezeichnet, deren Schnittpunkte
mit der GOK horizontal bis max. 10 m Abstand von der Böschungskrone liegen.4Der Tabellenwert für tiefe Bruchmechanismen wurde für den horizontalen Abstand von 150 m
von der Böschungskrone ermittelt. Liegen die Schnittpunkte mit der GOK zwischen 10 m und
150 m von der Böschungskrone entfernt, so kann linear zwischen beiden Werten interpoliert
werden.6 Anhang
Rechenbeispiele zur Ermittlung der Bodenbeschleunigung für pseudo-statische Verfahren
(nach dem Gutachten von Prof. Triantafyllidis und den Daten des GFZ Potsdam)
Für den Restsee Inden werden für eine pseudo-statische Berechnung die anzusetzenden
Erdbebenbeschleunigungen und pseudo-statischen Koeffizienten ermittelt.Es sind vier Fälle zu unterscheiden, wobei jeweils von den horizontalen Beschleunigungen
ah ausgegangen wird:(1) Befüllphase, tiefliegende Bruchmechanismen
(2) Befüllphase, oberflächennahe Bruchmechanismen
(3) Endzustand, tiefliegende Bruchmechanismen
(4) Endzustand, oberflächennahe Bruchmechanismen
Die vertikalen Beschleunigungen lassen sich nach dem Zusammenhang av = 0,7·ah ermitteln.
Als Datengrundlage dient die interaktive Abfrage des GFZ Potsdam (Abb. 1)
Abb. 1: Abfragen der Spitzenbodenbeschleunigung (PGA) [4]
(Anmerkung: Der Begriff „mittlere Wiederholungsperiode“ entspricht dem Begriff „Wiederkehrperiode“)
(1) Für die Befüllphase ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 500 a maßgebend
= 0,10 zu berücksichtigen.
(analog zu DIN 19700 für Betriebserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich für die
Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ eine Spitzen-
bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 1,06 m/s². Gemäß Tabelle 1 ist für die
oben genannten Rahmenbedingungen für tiefliegende Bruchmechanismen der pseudostatische
KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung
ah =
· PGA = 0,106 m/s²(2) Für die Befüllphase ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 500 a maßgebend
= 0,25 zu berücksichtigen.
(analog zu DIN 19700 für Betriebserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich für die
Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ eine Spitzen-
bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 1,06 m/s². Gemäß Tabelle 1 ist für die
oben genannten Rahmenbedingungen für oberflächennahe Bruchmechanismen der pseudo-statische
KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung
ah =
· PGA = 0,265 m/s²(3) Für den Endzustand ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 2500 a maßgebend
= 0,10 zu berücksichtigen.
(analog zu DIN 19700 für Bemessungserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich für
die Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ eine
Spitzenbodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 2,10 m/s². Gemäß Tabelle 1
ist für die oben genannten Rahmenbedingungen für tiefliegende Bruchmechanismen der
pseudostatische KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung
ah =
· PGA = 0,210 m/s²(4) Für den Endzustand ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 2500 a maßgebend
= 0,25 zu berücksichtigen.
(analog zu DIN 19700 für Bemessungserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich
für die Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ
eine Spitzenbodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 2,10 m/s². Gemäß
Tabelle 1 ist für die oben genannten Rahmenbedingungen für oberflächennahe Bruchmechanismen
der pseudo-statische KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung
ah =
· PGA = 0,525 m/s²7 Literatur
[1] T. Triantafyllidis: Gutachterliche Stellungnahme zu Standsicherheitsberechnungen mit Ansatz
von „Erdbebenbeschleunigungen für Böschungen im Rheinischen Braunkohlenbergbau“ –
Überprüfung des quasistatischen Ansatzes der Erdbebenbeschleunigung bei Standsicherheits-
untersuchungen und Bewertung der Rechenverfahren zur Böschungsstabilität, Juni 2013[2] DIN 19700: Stauanlagen, Juli 2004
[3] Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - DIN EN 1998-1:2010-12;
DIN EN 1998-1/NA:2011-01; DIN EN 1998-5:2010-2012; DIN EN 1998-5/NA:2011-07,
2010-2011[4] Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ Potsdam): Interaktive Abfrage von Karten der
Erdbebengefährdung und Beschleunigungs-Antwortspektren für die Gefährdungsniveaus
gemäß DIN 197005[5] DIN 4149: Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und
Ausführung üblicher Hochbauten, April 2005[6] Merkblatt 58: Berücksichtigung von Erdbebenbelastungen nach DIN 19700,
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2006[7] T. Triantafyllidis und C. Grandas: Quasistatischer Ansatz der seismischen Anregung von
Böschungen mit nicht-linearer Wellenausbreitung, Bautechnik 90 (2013) Heft 1, Seiten 51ff.[8] C. Melo, S. Sharma: Seismic coefficients for pseudostatic slope analysis, 13th World
Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, Paper No. 369,
August 1-6, 2004[9] M.E. Hynes-Griffin, A.G. Franklin: Rationalizing the seismic coefficient method,
Department of the Army, US Army Corp of Engineers, CWIS Work Unit 31145, July 1984[10] I. Towhata: Geotechnical Earthquake Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
[11] M. Goldscheider: Ansatz von Wasserdrücken und Erdbebenlasten bei Geländebruch-
berechnungen mit Gleitkreisen, Bericht 3: Ansatz von Erdbebenlasten bei horizontalem
Grundwasserspiegel und Außenwasser, 07.05.2005 mit Berichtigung vom Juni 2011[12] M. Goldscheider: Das Verfahren der zusammengesetzten Bruchmechanismen für
Geländebruchberechnungen bei geschichteten Böschungen unter Wasserdrücken und
Erdbebenlasten, Bericht 8: Statik ebener zusammengesetzter Bruchmechanismen ohne
Lamellenschnitte, 21.03.2006 mit Berichtigung vom 02.11.2006[13] M. Goldscheider et al.: Berücksichtigung von Erdbeben bei Standsicherheitsberechnungen
für tiefe Endböschungen unter Wasser, World of Mining, 2010 No.55http://www-app1.gfz-potsdam.de/pb53/Koor/Koordinatenabfrage_DIN_html.php
bzw. http://dx.doi.org/10.5880/GFZ.2.6.2012.001
Bezirksregierung Arnsberg
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRWIm Auftrag:
A n d r e a s S i k o r s k i
- tektonischen Beanspruchungszonen, Schichtgrenzen oder Schichten mit geringer